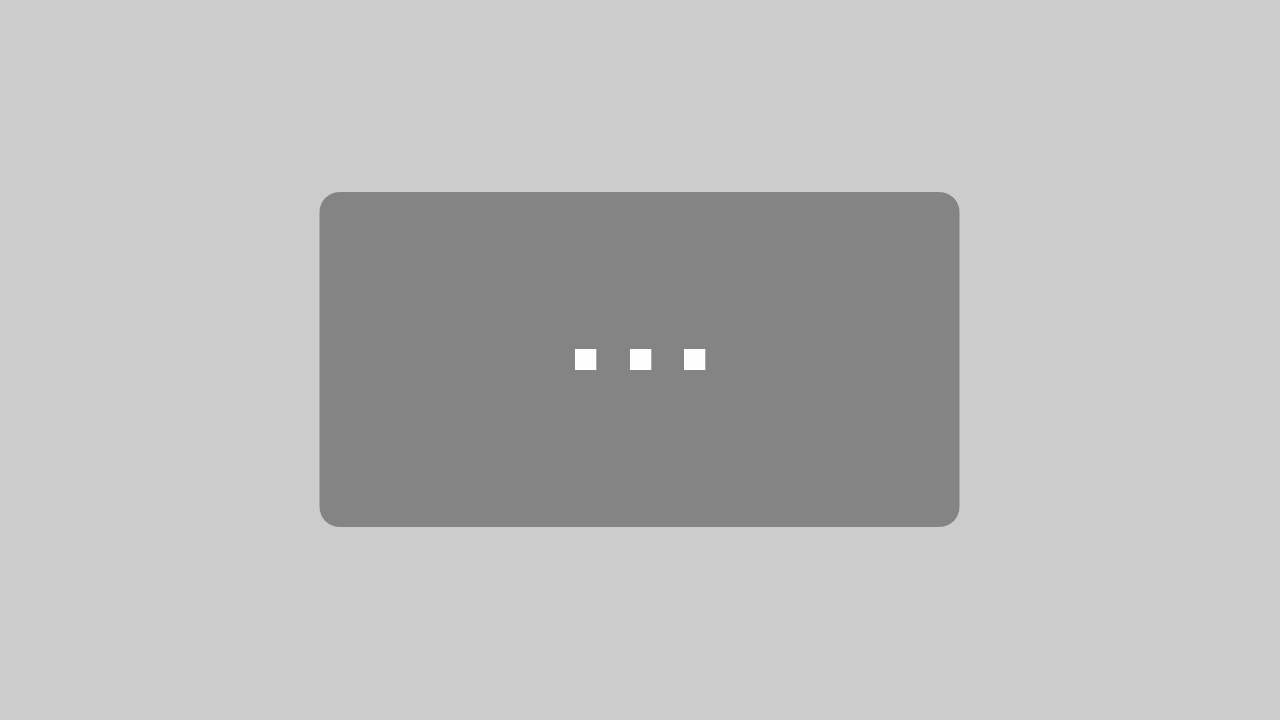Das Wort „kollaborativ“ hat einen tollen Klang. Da schwingt immer auch ein bisschen Süden mit. Wie ein Sauvignon Blanc an einem lauen Sommerabend im Loiretal. Nach dem zweiten Glas kann das Wort aber womöglich zum Zungenbrecher werden. Man weicht dann lieber auf das einfacher auszusprechende „kollektiv“ aus. Arbeiten im Kollektiv – das klingt dann nicht mehr so verführerisch, sondern riecht eher nach Planwirtschaft. Jeder wurschtelt vor sich hin, und am Ende purzelt ein wackeliger Lada vom Fließband. Womit wir beim Thema wären: Findige Entwickler haben uns eine Vielzahl von neuen Tools für das zeitgemäße kollaborative Arbeiten beschert. Asana, Slack, Trello und, und, und. Sie alle wollen das Projektmanagement besser, effizienter, transparenter machen. Die Idee dahinter ist bestechend: Jeder verschiebt hier entsprechend dem aktuellen Status seine Projekte, löscht sie und schaut in schöner Regelmäßigkeit nach dem Fortlauf des Projektes. Alle sind also immer auf dem gleichen Stand. Nicht nur die Projektarbeit ist kollaborativ, sondern auch auch gleich dessen gesamte Steuerung. Toll. Aber in der Praxis häufig so erfolgreich wie eben die Planwirtschaft.
Wir – also vor allem wir Digital Immigrants – sind mit dem Bewusstsein in die Arbeitswelt gewachsen, dass alles klare Verantwortlichkeiten braucht, sonst schleicht sich schnell der Schlendrian ein. Und auch dem so populär gewordenen agilen Arbeiten können wir einiges abgewinnen, weil ja auch hier die Rollen (ScrumMaster, Product-Owner etc.) recht klar geregelt sind. Mit den Colloboration-Tools hadern wir allerdings: Dass jeder ganz selbstlos eine weitere, immer wiederkehrende administrative Tätigkeit für das große Ganze übernimmt – so viel Altruismus haben wir selten erlebt. Das verlangt von allen Mitwirkenden schließlich einen Grad der Selbstdisziplin wie wir ihn allenfalls von den Shaolin-Mönchen nach jahzehntelangem Training in ihrem kargen Klosteralltag kennen. Vor allem: Sobald nur einer seine – wie man so schön sagt – Tasks hier nicht richtig markiert, gerät schnell das ganze System ins Stocken.Es droht akuter Projektstau – wie eben am Stadtverkehr: alles fließt, aber wehe eine Ampel fällt aus, dann herrscht schnell Chaos. Und je mehr an dem Projekt beteiligt sind, desto fehleranfälliger wird die ganze Chose. Insgeheim, der Verdacht beschleicht einen manchmal, wissen das alle. Und so kommt es in der Praxis zu allerhand skurrilen Situationen, wenn etwa Beraterinnen hier bei uns die wichtigsten to do’s parallel auf Word- und Excel-Sheets speichern. Man kann das als hoffnungslos rückständig belächeln, doch folgt das einer gewissen inneren Logik: Nicht selten wollen Kunden die Meilensteine der kommenden Tage eben ganz gern nochmal als E-Mail gesandt haben, manchmal wollen sie den jeweils aktuellen Status der Projekte auch lieber gemeinsam mit der Agentur in Asana, Slack und Co verzeichnen. So oder so: Das System der Planungs-Tools wird damit natürlich in weiten Teilen ad absurdum geführt, es verkümmert zu einer Projektdokumentation.
Etwas beruhigendes hat das: Je mehr die Digitalisierung auch an Fahrt gewinnt, die Evolution kann sie trotzdem nicht überlisten. Schon ein persönlich geführter Dialog gestaltet sich ja manchmal bekanntlich schwierig und führt zu allerhand Missverständnissen. Das ist natürlich noch gar nichts gegen die E-Mail-Kommunikation – vor allem dann, wenn ein Sender gleich mehrere Adressaten mit heimtückisch offen gestellten Fragen wie „Was meint Ihr dazu?“ traktiert. Ein Kinderspiel allerdings im Vergleich zu den neuen Wunderwaffen im Projektmanagement: Im übertragenen Sinne flüstert hier jeder seinen kleinen Beitrag in den Runde ohne dafür jemals Feedback zu bekommen. Trotzdem bleibt jeder hochmotiviert bei der Sache. Tja, und wer da nicht mitmacht, untergräbt die eigenen Interessen, ist also ein – Kollaborateur.
Kategorie: Allgemein
Die PM ist tot. Es lebe die PM! Kein Medium in unserem Beruf als PR-Berater ist gleichzeitig so zentral und so umstritten wie die Pressemitteilung. Es gibt zwei Lager: Auf der einen Seite die PM-Jünger, die am liebsten jede noch so kleine Kleinigkeit an den großen Verteiler schicken würden, auf der anderen Seite die PM-Verächter, die die klassische Pressemitteilung schon längst in Rente sehen. Irgendwie führt aber doch kein Weg an ihr vorbei.
Das gespaltene Image der PM liegt vielleicht auch daran, dass der Versand hauptsächlich via E-Mail passiert. Weil Journalisten und PRler von gestern sind? Vielleicht. Oder weil es für den breiten Versand keine Alternative gibt? Natürlich gibt es Presseportale, die im Ruf stehen Pressemitteilungen mit ihren Newslettern noch mehr Reichweite zu verschaffen als beim Versand per Mail. Allerdings ist es schwer nachprüfbar, ob Journalisten – und vor allem diejenigen, die man erreichen will – den Service nutzen oder die PMs dort eben ungesehen bleiben. Unsere Erfahrungen mit Presseportalen sind eher negativ. Der Versand per Mail an einen ausgewählten Kreis ist da schon persönlicher. Gerade in unserer doch eher kleinen Nische, haben wir viel Kontakt zu den entsprechenden Journalisten, man trifft sich auf Veranstaltungen und telefoniert häufig.
Sie liebten und sie hassten sie
Wenn da wiederum nicht der schlechte Ruf der E-Mails wäre. Die Postfächer von Journalisten sind so voll wie die U-Bahn am Feierabend – nur eben den ganzen Tag – und leider oft auch mit Themen, die ganz offensichtlich nicht relevant sind. Kein Wunder, dass der Unmut also ziemlich groß ist. Fragt man Journalisten, wie man denn am liebsten in Kontakt treten sollte, wohnt man einer Dr. Jekyll-Mr. Hyde-artigen Szene bei: Bitte keine Mails … (kurzer Seufzer) … aber bitte unbedingt Mails schicken! Wieso? Weil sie nun einmal die einzig wahre Möglichkeit sind, Journalisten mit tagesaktuellen Infos aus dem Unternehmen zu versorgen.
RSS-Feed – gute Alternative?
So kamen wir vor Kurzen im Gespräch mit einem Journalisten zu der Diskussion wie es denn wäre, wenn Unternehmen Journalisten ausschließlich über RSS-Feeds mit ihren Informationen versorgen würden? Durch eine immer buntere digitale Blog-Landschaft erfreuen sich RSS-Feeds großer Beliebtheit. Es ist schon praktisch, wenn man sich bestimmte Themen, die man verfolgen möchte, abonnieren kann. Aber wie sähe die Umsetzung in der PR aus? Unternehmen würden Inhalte nur noch über ihre Website teilen und Journalisten würden dann die RSS-Feeds bestimmter Unternehmen, bzw. Themen abonnieren und so an die Informationen kommen. Also Pull-Prinzip statt Push.
Das hätte eine Menge Vorteile, denn Journalisten können ganz gezielt nach ihren Interessen auswählen und so könnten Nischenthemen eventuell eine höhere Aufmerksamkeit generieren und im riesigen Informationsgedränge besser durchkommen. Außerdem hieße das, das strenge formale Korsett von offiziellen Presseaussendungen zu lockern und somit mehr Formatvielfalt zu fördern.
Nachteile gäbe es natürlich auch, denn die Beziehung wäre sehr einseitig. Die Möglichkeit Themen vorab persönlich anzuschubsen wäre passé, Inspiration für Themen außerhalb des definierten Interessenfelds und der Blick über den Tellerrand wären vorbei und die Hürde in den Dialog zu treten wäre höher.
In der Konsequenz heißt das, dass der RSS-Feed zwar ein guter zusätzlicher Kanal für beide Seiten ist, dass aber gleichzeitig (noch) kein Weg am klassischen Versand per Mail vorbeiführt. Wir werden wohl auch in Zukunft diesen Weg wählen und die Postfächer der Journalisten dieser Welt füllen – natürlich mit Sinn und Verstand! 😉
P.S.: „Bei den Unter-35-Jährigen sind Unternehmensmeldungen mit 92 Prozent sogar die wichtigste Recherchequelle“, haben die KollegInnen von newsaktuell ermittelt.
Wladimir Klitschko, das hat uns schon ziemlich beeindruckt, liebe Horizont. Der erste Gast im hauseigenen Podcast: ein echtes Idol – sympathisch, gerade heraus, auf den Punkt. Ein inspirierendes Gespräch über Digitalmarketing, Testimonials und natürlich Boxen. Relevante Themen, souveräne Stimmen, genau das Richtige, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir inzwischen so gerne Podcasts hören. Es ist entspannend einfach mal nur zuzuhören, ohne dass das Gegenüber eine schlaue Antwort erwartet. Meetings und Calls haben wir schließlich alle genug. Stattdessen mal im Laid-Back-Modus einfach nur zuhören – das ist eine willkommene Abwechslung. Und weil auch unsere Kernbranchen inzwischen den einen oder anderen Podcast ins Leben gerufen haben und dieser sich still und heimlich in seiner total unspektakulären Art zum absoluten In-Medium gemausert hat, widmen wir ihm heute einen Blogbeitrag. Hier kommen unsere fünf Favoriten:
Techies und alle, die es werden wollen, aufgepasst: Im t3n-Podcast „Filterblase“ kommen die aktuellsten Tech-Themen auf den Tisch, beziehungsweise ins Ohr. Die beiden Chefredakteure Luca Caracciolo und Stephan Dörner diskutieren mit Experten in einer knackigen halben Stunde über Themen wie Digitalisierung & GroKo, KI, Bitcoins, Startup-Finanzierung und den 5-Stunden-Tag – immer mit der entscheidenden Note Tech.
Moment mal, müssen wir hier überhaupt noch etwas erklären? Ne! Philipp Westermeyers Channel ist einfach DER Online-Marketing-Podcast Deutschlands mit DEN Experten.
Es ist jetzt so ziemlich genau ein Jahr her, dass Sachar Klein und Timo Lommatzsch ihren Podcast „Talking Digital“ starteten. In der Zwischenzeit haben die beiden PR-Profis mit Experten wie Sandra Liebich von news aktuell, Petra Reetz von der BVG und Frank Behrendt von Serviceplan über alles rund um digitale Unternehmenskommunikation und PR gesprochen. Mit einer guten Dreiviertelstunde sind die Podcasts perfektes Mittagspausenfutter. (Unser Highlight ist Folge 7: ein Gespräch mit Dirk Eichhorn zum Thema Kommunikation für „Die drei ???“ in digitalen Zeiten.)
Dem frischgeschlüpften Horizont-Podcast gewähren wir an dieser Stelle ein paar Vorschusslorbeeren. Was man nach der ersten Folge schon sagen kann: Die Qualität der Aufnahme stimmt, der erste Gast hat gesessen und wir sind bis zum Schluss drangeblieben. Wir hören also gespannt weiter und rechnen jetzt für die nächste Folge ganz fest mit Oliver Kahn.
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer gibt Tipps, wie Sie sich am Arbeitsplatz fit halten – zum Schrecken aller Betriebssicherheitsbeauftragten, nämlich indem Sie sich unter den Schreibtisch hängen und Klimmzüge machen – Patricia Riekel, ehemalige Chefredakteurin der „Bunte“, erklärt, wie Sie richtig netzwerken, Telekom-Vorständin Claudia Nemat macht den Chef zum Coach und der Gründer des Vegane-Kondome-Startups „Einhorn“ erzählt wie das so war, als die ganze Firma auf agil umgekrempelt wurde. Das ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Themen des XING-Videopodcasts. Die Interviews dauern circa 30 Minuten und wer nicht so viel Zeit hat, der findet auch eine gekürzte Version mit den wichtigsten Botschaften in knapp fünf Minuten.
Viel Spaß beim Zuhören!
Der War for Talents in der Digital-Branche ist in vollem Gange. Entsprechend ziehen Unternehmen sämtliche Register, um im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber bei den Young Professionals möglichst weit vorne zu liegen. Eine einfache Anzeige bei Monster.de ist dabei längst mehr nicht der Schlüssel zum Mitarbeiter-Glück – insbesondere wenn am Ende der Bewerbungsphase ein neuer, qualifizierter Junior Marketing Manager stehen sollte. Wer auf der Suche nach fitten – und bestenfalls auch noch kreativen – Digital Natives ist, sollte den Köder in für sie heimische Gewässer werfen. Denn im digitalen Business mit einer klassischen Print-Anzeige auf Bewerberfang zu gehen, ist ungefähr so zeitgemäß wie ein Modem in Zeiten von Smart Home.

Eine gute Möglichkeit hierzu stellt Instagram dar. Nicht nur, weil die Plattform mit 15. Mio aktiven Nutzern mittlerweile Platz 2 der beliebtesten Social Networks in Deutschland hinter Facebook (30 Mio.) besetzt, sondern auch weil sie alleine schon aufgrund ihrer Mechanik – dem Fokus auf Fotos und Bewegtbild – dazu einlädt, Follower zu inspirieren und zu binden. Kein Wunder also, dass weltweit die Anzahl der aktiven Unternehmensprofile allein zwischen März 2017 und August 2017 von acht auf 15 Millionen gewachsen ist – Tendenz steigend.
Das Problem jedoch: Insbesondere für kleinere Agenturen stellen Extrakosten, Personalengpässe und festgefahrene Strukturen eine große Hemmschwelle dar, das unbekannte Terrain „Instagram“ zu betreten. Dabei kann sich eine gute Präsentation ausgerechnet für sie als besonders lohnenswert herausstellen: So sehen sie sich als Dienstleister ständig denselben Vorwürfen konfrontiert – Stress, Überstunden und damit eine unausgeglichene Work-Life-Balance. Umso wichtiger ist es also, jede Chance nutzen, mit Vorurteilen aufzuräumen und mittels einer ansprechenden Social Media Präsenz Young Talents zu akquirieren.
Auch wir bei cocodibu haben uns im Sommer vergangenen Jahres für die Umsetzung eines eigenen Instagram-Accounts entschieden. Und – zugegeben – auch bei uns waren die Zweifel erst einmal groß: Wer soll sich darum kümmern? Wie lautet unsere Kernbotschaft und wie sehen entsprechend die Inhalte aus? Heute möchte ich nach etwas über einem halben Jahr Bilanz ziehen: Und klar, – den romantischen Vorsatz wöchentlicher Posts musste ich aufgrund des Tagesgeschäfts leider ablegen. Nichtsdestotrotz bin ich – nicht nur als eine der Kanal-Verantwortlichen, sondern auch als Kernzielgruppe – der festen Überzeugung: Wer im War for Talents Stärke beweisen möchte, sollte sich mit einer Instagram-Präsenz rüsten.
1. Alle für einen (Account)
Der Altersdurchschnitt von Agentur-Mitarbeitern liegt laut Statista bei unter 30 Jahren. Das heißt: Ein Großteil der Angestellten ist mit den Mechaniken der Plattform vertraut. Das erleichtert zum einen die Suche nach einem Kanal-Verantwortlichen und nimmt zusätzlich den Druck auf Seiten des Einzelnen – so können sich schließlich alle aktiv an der Gestaltung des Feeds beteiligen. Unsere Agentur spiegelt das ganz gut wider: Die meisten unter 30 Jahren – besitzen alle neben einem großen Interesse auch Zugriff auf unseren Account.
2. Erwartungshaltung
Oftmals zögern Unternehmen und Agenturen mit der Idee, eigene Content-Formate oder Social Media-Kanäle umzusetzen, aus Angst, Qualitätsansprüchen der Followerschaft nicht gerecht zu werden. So gerät der eine oder andere Geschäftsführer beim Gedanken an eine Posting-Anarchie vielleicht sogar in Schnappatmung. Bei Coca Cola, Siemens und der Website der Landesregierung mag die Gefahr eines Image-Schadens auch zutreffen – bei Accounts von kleineren Unternehmen und Agenturen liegt die Toleranzgrenze der Follower jedoch weitaus höher. Außerdem: Die Digital Natives sind alle mit den Mechaniken und Regeln von Social Media aufgewachsen, entsprechend gut ist auch ihr Gespür dafür, welche Inhalte sich für Social Media eignen und welche nicht. So bringt die Regel “Poste das, was Du selbst sehen wollen würdest”, nicht nur einen vielfältigen Feed, sondern spiegelt im besten Fall auch die verschiedenen Charaktere und deren Zusammenspiel in der Agentur wider – das absolute Nonplusultra für einen authentischen Social Media-Auftritt.
3. What to post?
Apropos authentischer Auftritt : Insbesondere auf Instagram – das Tool, das für echte, inspirierende und lebensnahe Inhalte steht – geht es weniger darum, hochkarätigen als ehrlichen Content zu posten. Ziel ist es jederzeit, das Agenturleben möglichst realitätsnah zu porträtieren. Social Media-Experten nennen dieses Phänomen auch “pretty ugly”. Das gilt für Agenturen auf Mitarbeitersuche sogar noch mehr als für die private Instagram-Nutzung. Anstatt die Follower mit steif-inszenierten Bildern zu langweilen, sollte man den Fokus lieber auf die Mitarbeiter legen – das können Impressionen aus dem Büroalltag sein oder einfach der schlafende Bürohund. Ähnlich flexibel verhält es sich auch mit der Posting-Frequenz: Lieber seltener posten, aber dafür in natürlichen Situationen – wie beispielsweise beim gemeinsamen Kicker-Abend. Das bringt mehr Sympathiepunkte – und entsprechend auch Likes und Reichweite – als das gestellte Mitarbeiterfoto im Hausflur.
4. Spontaneität schlägt Bürokratie
Gleiches gilt für Geburtstage, den Einstand oder Abschied von Mitarbeitern oder für den alljährlichen Wiesn-Besuch. Denn: Auch im stressigen Agentur-Alltag gibt es Situationen fernab von Posts-its und Dokumenten, die „worth to post“ sind. Insbesondere interne Agentur-Veranstaltungen bilden dabei die ideale Basis, um Spaß und Team-Zusammenhalt nach außen zu kommunizieren. Plus: Wieso nicht einfach mal via Instagram einem Kunden zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren? Das freut nicht nur das Geburtstagskind (im besten Fall bedankt es sich ja mit einer Rückverlinkung #Reichweite), sondern ist zusätzlich der ideale Point of Proof für die so oft gepredigte Flexibilität, Kreativität und Agilität in Agenturen.
5. Alleinstellungsmerkmal
Oft scheitert die Umsetzung einer eigenen Social Media-Präsenz an der Suche nach einem Maskottchen, einem Symbol mit besonderem Wiedererkennungswert. Warum? Kommunikationsbeauftragte sind es seit jeher gewohnt, Kanäle mit spezifischen Botschaften zu bespielen – sie suchen also nach einem Pendant für den klassischen TV-Slogan oder Jingle. Instagram tickt da aber völlig anders als TV, Radio und Co. (sh. Punkt 3 und 4). Haben Unternehmen das verstanden, kann sich das für sie wirklich mit vielen Followern auszahlen.
6.#Struggle
Bekannt für das Raute-Zeichen, impliziert die Plattform scheinbar, eine Präsenz wäre untrennbar mit einem eigenen Hashtag verbunden. Ein Trugschluss, wie ich finde – denn: Hashtags dienen im ersten Schritt der Kategorisierung und Auffindbarkeit der Inhalte. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ein guter, eigener Hashtag ist zwar “nice to have”, allerdings noch lange keine Garantie für eine erfolgreiche Instagram-Präsenz. Die Crux liegt vielmehr darin, mit den eigenen Inhalten und dazu passenden Hashtags die Auffindbarkeit des Accounts step-by-step zu pushen: Erst anschließend lohnt es sich wirklich, über einen eigenen Hashtag nachzudenken (eine Auflistung beliebter, themenbezogener Hashtags finden Sie übrigens bei den Kollegen von OnlineMarketing.de). Anders ist es im Rahmen eines eigenen Firmenevents. Hier lohnt es sich unter Reichweiten-Aspekten, seine Gäste dazu aufzurufen, die Partyfotos unter dem “firmen-eigenen” Hashtag zu veröffentlichen.
Fazit
Soziale Netzwerke wie Instagram erfreuen sich gerade deshalb besonderer Beliebtheit, weil sie Kommunikation vereinfachen. Weil sie Menschen und Unternehmen, nahbar machen. Weil sie Kommunikationswege verkürzen und interessierte Follower und Abonnenten immer Uptodate halten. Entsprechend sollten Unternehmen und Agenturen ihre erlernten Fesseln ablegen und Instagram als Recruiting-Tool eine echte Chance geben – ohne ausgeklügelten Content-Plan, besonderes Maskottchen oder erzwungenen Hashtag. Dafür aber mit viel Herz, authentischen Inhalten und eben einem Glas Sekt zum Feierabend – #Cheers!
Vor gesunder Ernährung ist niemand mehr sicher. Die breite Masse der Sport- und Ernährungspropheten predigt: Du bist, was du isst. In etwas abgewandelter Form gilt das auch für uns digitale Kommunikationsexperten. Unser Leitmotto: Du bist, was zu zeigst – ob online oder offline. Das klingt jetzt zunächst wie ein Ratschlag für all diejenigen, die ihr Glück als Influencer versuchen wollen, hat aber eine gänzlich andere Stoßrichtung. Unser Ziel im Web: die Social Media-Muskeln spielen lassen und für die Unternehmen repräsentative, informative und unterhaltsame (Social Media-) Kanäle aufzubauen, die weder langweilen noch zu aufdringlich sind. Die Relevanz einer ordentlichen Social Media-Präsenz ist inzwischen jedem klar. Der Zuspruch schwankt zwischen notwendigem Übel und willkommener Möglichkeit zur Kommunikation nach außen und innen.
Die digitale Vitamin-B-Bilanz aufpolieren
Nicht mehr ganz so rosig sehen das viele Kunden aber, wenn es um das Thema Blog geht. Sozusagen das digitale Äquivalent zum Spinat. Wenig beliebt, trotzdem ganz gut für die (digitale) Vitamin-B-Bilanz, also wichtig. So ist der Blog der Content Hub für alle Social Media-Aktivitäten und eine gar nicht mal so teure Möglichkeit für das Unternehmen nach außen zu kommunizieren, sich selbst darzustellen und ganz nebenbei auch eine SEO-Kur für die Webseite.
Entsprechend euphorisch preisen wir den Blog auch bei unseren Kunden an. Doch noch halten sich einige Vorurteile. Aber wieso ist das eigentlich so?
(Vermeintlich) ein riesiger Berg an Arbeit
Die scheinbare Hürde, die ein eigener Corporate Blog darstellt, lässt viele Kunden davor zurückschrecken. Als Begründung wird meist ein riesiger Berg an Arbeit angegeben, den die Verantwortlichen auf sich zurollen sehen. Das ist nur zu verständlich, schließlich weiß jeder, wie viel Zeit einem täglich für Zusatzarbeiten bleibt – so gut wie keine. Dass es so manch einem vor Spinat graut, mag wahr sein, dass Blogs zwangsläufig zu einem immensen Berg an Mehrarbeit führen, ist aber ein Mythos.
Jedes Unternehmen kann es mit oder ohne Hilfe schaffen, da alles eine Sache der Planung und der Erwartungen an den eigenen Blog ist. KPIs sollten deshalb nicht zu hoch angesetzt werden. Setzen Sie sich realistische Ziele und bestimmen Sie Ihre Zielgruppen. Manche Blogs sollen bestehende und potentielle Kunden ansprechen, andere potentiellen neue Mitarbeitern einen Einblick ins Unternehmen geben. Wiederum andere sollen in erster Linie Multiplikatoren – also Journalisten – ansprechen. Nur weil sich nicht aus jedem Blog-Beitrag sofort ein Lead oder neuer Kollege ergibt, heißt es nicht, dass Sie damit keinen wertvollen Beitrag in Ihrer Kommunikation leisten. Es kommt auf das große Ganze an, das Bild, das Sie nach außen darstellen.
Für jedes Problem eine Lösung
Sie müssen nicht in Dauerschleife Inhalte erstellen und das Rad neu erfinden. Ein bis zwei Beiträge in der Woche reichen schon aus. Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter in die Pflicht. Wenn jeder etwas zum Blog beiträgt, verteilt sich die Last auf viele Schultern und bedeutet so nur einen minimalen Aufwand pro Person und Zeiteinheit. Natürlich schreibt nicht jeder gerne und manche ergreift die blanke Panik, wenn ein weißes Papier vor ihnen liegt. Aber das ist lösbar. Entwickeln Sie Formate, die regelmäßig auf dem Blog erscheinen. Das können Fragebögen, aber auch Rankings oder kurze, bildstarke Beiträge sein. Einen Fragebogen beantworten kann jeder und der Vorteil dabei ist, dass die meisten Menschen wesentlich lieber Interviews lesen – die sind schließlich authentischer. Fragebögen sind aber nicht nur etwas für Mitarbeiter. Nutzen Sie Ihre Community. Interviews mit anderen Experten schaffen Mehrwert und machen das Unternehmen sympathisch, denn nichts ist schlimmer als pausenlose Eigenwerbung.
Ist der erste Schritt einmal gemacht, verliert der Unternehmensblog schnell an Grauen. Der digitale Vitamin-B-Spiegel steigt und spätestens, wenn Sie der erste Kunde oder Bewerber auf Ihren gelungenen Blog anspricht, sind alle Strapazen vergessen. Gedruckte Visitenkarten reichen eben nicht mehr aus.

Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, vernetzte Geräte, Chatbots, Robo-Beratung: Digitale Technologien beeinflussen derzeit die gesamte Wirtschaft enorm – und damit auch die Versicherungsbranche. Aber welche dieser Entwicklungen wirken sich wie auf das Geschäft von Allianz, AXA, Ergo, HUK & Co. aus? Die Digital Insurance Agenda (DIA), die am 10. und 11. Mai in Amsterdam stattfindet, bietet für sowohl für die jungen InsurTechs als auch für die Entscheider aus alteingesessenen Versicherungsunternehmen die seltene Gelegenheit, sich in nur zwei Tagen auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir haben mit den DIA-Gründern Reggy de Feniks und Roger Peverelli darüber gesprochen, was gerade auf der digitalen Agenda der Versicherungsbranche steht.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Digital Insurance Agenda zu veranstalten?
Roger Peverelli: Nachdem wir unser letztes Buch „Wie sich die Finanzbranche neu erfindet“ veröffentlicht haben, wurden wir in viele Vorstandsetagen von Versicherungen eingeladen. Und auch in unserer Arbeit als Berater für diverse große und kleinere Versicherer haben wir gemerkt, dass mittlerweile jeder verstanden hat, wie notwendig Innovation ist. Gleichzeitig schafft die neueste Technologie die Voraussetzung dafür, Kosten zu senken und dem Kunden näher zu kommen.
Reggy de Feniks: Als Einzelversicherer ist es fast unmöglich, die komplette InsurTech-Szene genau zu beobachten. Und umgekehrt finden es die InsurTechs sehr schwer, sich mit den Versicherungen zu vernetzen, da der Markt stark fragmentiert ist und es unzählbare, oft lokale Akteure gibt. Als wir das realisiert hatten, haben wir beschlossen, die Digital Insurance Agenda zu veranstalten.

Welche Ziele setzen Sie sich mit der DIA?
Peverelli: Letztlich ist es das Ziel, Innovation in der Versicherungsbranche zu beschleunigen. Wir tun das, indem wir Führungskräfte von Versicherungen mit von uns ausgewählten InsurTechs zusammenbringen. Viele Versicherungsunternehmen sind mit digitaler Transformation beschäftigt, um Prozesse zu digitalisieren, im operativen Geschäft effizienter zu werden und Kosten zu senken. Manche setzen bereits digitale Lösungen ein, um ihr Geschäft zu verbessern: Dazu gehören Lösungen, um die Kundenbindung zu verbessern und Maklern, Vertretern und anderen Mitarbeitern mit direktem Kundenkontakt mehr Möglichkeiten zu bieten. Durch die Verbindung der Versicherer mit den besten InsurTechs werden die Unternehmen in die Lage gebracht, im Tempo mit den steigenden Kundenanforderungen und den digitalen technologischen Möglichkeiten zu bleiben. Dies führt zu einer besseren Leistung, sowohl für den Kunden als auch für die Versicherungsgesellschaft.
Wie werden die InsurTechs ausgewählt, die sich in Amsterdam präsentieren?
De Feniks: Wir haben eine recht vollständige Übersicht über alle Versicherungsunternehmen in der Welt. Momentan listen wir rund 1.000 in unserer Datenbank, aber die Zahl wächst jeden Tag. InsurTechs, die bei der DIA auftreten wollen, müssen sich bewerben und einen Auswahlprozess durchlaufen. Dabei schauen wir, ob ihre Lösungen wirklich innovativ und vor allem dazu geeignet sind, von Versicherungsunternehmen implementiert zu werden. Aber das wichtigste Kriterium ist, dass die Lösungen gegen die Herausforderungen wappnen sollen, denen Versicherungsunternehmen heute und morgen gegenüberstehen. Was sind die Einflüsse auf die Kosten, auf die Kundenzufriedenheit, auf die Maklerzufriedenheit?
Wie sieht das Programm der DIA aus?
Peverelli: Die DIA ist eine zweitägige Veranstaltung. Über 50 der von uns ausgewählten InsurTechs werden ihre Lösungen in zehnminütigen „Show & Tell“-Demos auf der Bühne präsentieren. Dabei gibt es keine Powerpoint-Slides, sondern echte Demos, damit jeder im Raum sehen kann, wie die Lösungen wirklich funktionieren und wie sie bei ihren eigenen geschäftlichen Herausforderungen helfen könnten. Wir freuen uns auf eine großartige Mischung aus Startups, ausgereiften Lösungen von innovativen Akteuren sowie den neuesten Informationen von namhaften Tech-Anbietern. Darüber hinaus teilen Branchenführer in fünf Keynotes und Podiumsdiskussionen ihr Wissen und geben Handlungsempfehlungen, wie die Zusammenarbeit mit InsurTechs erfolgreich wird. Auf der Bühne stehen werden unter anderem Amélie Oudea Castera, Chief Marketing & Digital Officer der AXA Group und Mark Klein, Chief Digital Officer von ERGO Digital Ventures.
Welche Trends und Innovationen prägen den Markt in diesem Jahr?
De Feniks: Derzeit können wir beobachten, dass künstliche Intelligenz und Machine Learning sich stark weiterentwickeln. Blockchain zeigt einige spannende Anwendungsfälle. Und das gleiche gilt für Connected Devices, Telematik und all den Mehrwert, den man aus Daten ziehen kann – nicht nur für das komplexere Versicherungsgeschäft, sondern auch für alle möglichen neuen Services. Darüber hinaus bemerken wir viel mehr Aufmerksamkeit für die Herausforderung, Makler und Agenten zu befähigen und zu stärken. Immer mehr Versicherungsunternehmen erkennen, dass die digitale Transformation auch eine Gefahr in sich birgt und sie sich dadurch noch weiter von den Kunden entfernen könnten. Wir sehen aktuell viele Chatbot- und Robo-Beratungslösungen, die Makler, Vertreter und andere dabei unterstützen, um bessere Gesprächen, eine verbesserte Zufriedenheit bei den Kunden und höhere Conversion-Rates zu erlangen.
Was ist das Zielpublikum der DIA und warum empfehlen Sie die Teilnahme?
Peverelli: Im vergangenen Jahr in Barcelona zählten wir 550 Besucher aus 36 verschiedenen Ländern, die die DIA zur größten Veranstaltung und „Must see“ im Bereich InsurTech und Versicherung weltweit gemacht haben. Die vertretenen Firmen variieren von den bekannten großen Namen bis hin zu kleineren Herausforderern und decken die ganze Bandbreite von Maklern, Versicherungen bis hin zu Rückversicherern ab. Die Jobtitel der Führungskräfte reichen von Innovations- und Forderungsmanagern über Leiter der Datenanalytik, Marketing Directors, IT-Führungskräfte, Digital Transformation Officers, Head of Change Management bis hin zu Chief Operating Officers und CEOs. Die DIA bietet eine großartige Gelegenheit, Fachkollegen aus der ganzen Welt zu treffen und Ideen zu teilen. Darüber hinaus ist es in meinen Augen die beste Möglichkeit, um in nur zwei Tagen zu lernen, was der aktuelle Stand der Technik ist und sich dazu inspirieren zu lassen, die eigenen Innovationen zu beschleunigen.
cocodibu ist offizieller Unterstützer der DIA Amsterdam 2017 und bietet interessierten Teilnehmern einen Sonderrabatt von 200 Euro auf den Eintrittspreis. Den Rabattcode DIA2017COCODIBU200 können Sie auf http://www.digitalinsuranceagenda.com/dia-amsterdam/#register einlösen.
Mit 750 erwarteten Teilnehmern aus 36 Ländern und über 50 InsurTechs auf der Bühne ist die DIA eines der weltweit größten Events für InsurTechs und Innovation in der Versicherungsbranche. Sie findet am 10. und 11. Mai 2017 in der Westergasfabriek in Amsterdam statt. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.digitalinsuranceagenda.com/dia-amsterdam/.

Man muss nicht gleich eine Revolution ausrufen, um ein Buch über Content Marketing zu schreiben. Man kann sich auch mehr als zwei Jahrzehnte mit den Themen SEO und Hirnforschung beschäftigen und dann seine Gedanken zu Papier bringen. Steven Broschart und Rainer Monschein haben den zweiten, zweifelsfrei unspektakuläreren Weg gewählt. Herausgekommen ist der Wälzer „Der Content-Faktor“ – ein 540 Seiten starker Oschi, der über SEO und die kognitive Verarbeitung von Inhalten hin zur Content-Erstellung leitet.
Und wahrscheinlich ist genau das eine der wesentlichen Stärken des Buches: die Interdisziplinarität. Denn mal ehrlich: Wo gibt’s die denn? So predigen wir Agenturen unseren Auftraggebern zwar gebetsmühlenartig, endlich die alten Abteilungs-Silos abzureißen, sind allerdings allzu oft selbst in diesen gefangen. Content-Marketing-Firmen kaufen Content-Marketing-Firmen, SEO-Experten schreiben für die SEO-Szene und KI-Tüftler – na gut, die müssen wir erst mal richtig kennenlernen. Oder wie die beiden Autoren im Vorwort schreiben: „Niemand kann alles wissen. Deshalb wird auch im Online Marketing das Wissen zumeist in Silos gemanagt. So existieren Disziplinen wie beispielsweise die Conversion-Optimierung und das Suchmaschinenmarketing ebenso parallel wie in der Medizin der Internist und der Chirurg – also ohne, dass das Wissen ausreichend ‚quer verlinkt‘ wird und neue Erkenntnisse, neue Lösungen abgeleitet werden können“. Genau hier setzt „Der Content-Faktor“ an. Man könnte auch sagen: warum erst jetzt?
Den – angesichts der Opulenz dieses Fachbuches durchaus vorhandenen – ersten Lesewiderstand zu überwinden, lohnt durchaus: Zum einen, weil die Autoren mit ihrer verständlichen Sprache es auch SEO-Amateuren leicht machen, dran zu bleiben, und so vergleichsweise mühelos auf den neuesten Stand in Sachen Google-Rankingfaktoren zu kommen – und darüber hinaus noch geballtes Wissen aus Psychologie, Neurologie und Soziologie mitnehmen. Zum anderen weil die zwei Experten anhand zahlreicher Beispiele – angefangen vom Wahlkampf des SPD-Kandidaten Peer Steinbrück bis zur originellen ebay-Anzeige als Beispiel für Storytelling – immer wieder den Brückenschlag in die Praxis schaffen.
Ihren Ursprung in der SEO-Szene können Steven Broschart und Rainer Monschein dabei kaum verhehlen: das Buch ist so analytisch-logisch aufgebaut, dass man sich bei der Abhandlung der eher kreativen Disziplinen wie Themenfindung und -aufbereitung unweigerlich fragt: Kann das gutgehen? Lässt sich Content tatsächlich herleiten? Die beiden Autoren meinen: grundsätzlich ja und empfehlen hier die aus den Hollywood-Filmen bekannte Methode: einleitende Beschreibung, Konflikt, Lösung. Funktioniert selbst bei Knorr-Rezepten, wie die beiden eindrucksvoll belegen. Und so sehr die Autoren einen Verkaufserfolg mit „Der Content-Faktor“ angesichts der wirklich professionellen Aufbereitung verdient hätten, man wünscht sich, dass möglichst viele Leser zumindest das eine Kapitel schnell überblättern. Denn man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn nun alle Tütensuppenfirmen, Büroklammerhersteller und Schnürsenkelproduzenten in Blockbustermanier auf ihren Websites einen Konflikt heraufbeschwören, der dann mit Filmkuss endet. Statt Happyend droht dann wahrscheinlich eher das Schicksal der Titanic: ein geradezu kollektiver Untergang in der Content-Flut. Wer will schon die immer gleiche – nur um Nuancen veränderte – Geschichte lesen? Das ist dann ähnlich den inflationär eingesetzten Listicles. Und da gibt es ja schließlich mindestens „Sieben Gründe, warum wir keine Listicles mehr lesen können“.

„Haben die eigentlich nicht gelernt, sich zu benehmen?“, habe ich mich schon häufig gefragt, wenn ich durch meinen privaten Newsfeed bei Facebook gescrollt habe. Menschen, die andere Menschen noch nicht einmal kennen, hauen dort teilweise unfaire und persönlich beleidigende Kommentare raus – das hat mit konstruktiver Kritik überhaupt nichts mehr zu tun. Ich frage mich, warum Menschen im Netz so häufig ihr gutes Benehmen verlieren und unter die Gürtellinie gehen. Im privaten Umfeld ist das die eine Sache, im beruflichen die andere – und für mich auch die weitaus unangenehmere und ein absolutes No Go.
Ich möchte an dieser Stelle keinen Knigge für das Verhalten im Netz verfassen, aber es gab einen Anlass, bei dem ich fand, dass das Verhalten einiger Facebook-User unterirdisch war. Ein Kunde wurde aufgrund eines Beitrags, den W&V auf Facebook veröffentlichte, recht persönlich angegangen. Kurz zusammengefasst: Es ging um die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz. Besagter Kunde schrieb einen Gastbeitrag dazu, warum die Bezeichnung Rockstar in der Digitalbranche eine gewisse Überhöhung der eigenen Tätigkeit suggeriert, die nicht notwendig ist. UNERHÖRT, wie kann denn jemand auf die Idee kommen, einfach so ungefragt Kritik an dem Event schlechthin zu üben? „Das geht gar nicht!“ dachten sich einige Facebook-User und machten ihrem Ärger unter dem Beitrag Luft. Was auffällig war: Die Kritik hatte mit dem Inhalt des Beitrags, abgesehen von einem einzigen Kommentar, rein gar nichts zu tun. Gestartet wurden hingegen persönliche Angriffe auf das Äußere des Kunden oder auf sein Unternehmen. Von Respekt überhaupt keine Spur. Scheinbar fühlten sich diese Facebook-User persönlich angegriffen. Das gibt aber, aus meiner Sicht, noch lange keinem das Recht, andere Menschen persönlich zu diffamieren. Was mich noch mehr verwundert hat, war, dass diese Leute sich keineswegs anonym geäußert haben, sondern mit ihren privaten Profilen dort kommentierten. Wohlgemerkt nicht auf privater Ebene, sondern auf einem Facebook-Profil, das viel mehr im beruflichen Alltag genutzt wird. Nachdem ich gemeinsam mit meinem Kunden eine Antwort verfasst hatte, in der wir noch einmal respektvoll darauf hinwiesen, was die eigentliche Aussage des Textes sein sollte, waren die Anfeindungen schnell vorbei. Die Lust an einer inhaltlichen Auseinandersetzung war augenscheinlich nicht gegeben. Oder war allein die Tatsache, dass der Angegriffene in die Diskussion eingriff, der Grund dafür, dass diese augenblicklich verebbte? Das wäre mehr als schwach!
Was ist online anders?
Debatten entgleisen im Internet viel schneller als Face-to-Face. Im besagten Fall kann ich mir kaum vorstellen, dass einer derjenigen, die kommentiert haben, meinem Kunden ihre Meinung so deutlich ins Gesicht gesagt hätte. Derartige Anfeindungen hätte ich auch eher im Kindergarten verortet, aber nicht unter Erwachsenen. Ich habe mich gefragt, warum Menschen so unfair reagieren: Neid, Unzufriedenheit, zu viel Zeit? Es geht wohl wieder mal um das Phänomen der „Unsichtbarkeit“. Ein Begriff aus der Fachsprache. Bedeutet nicht, dass sich Facebook-Nutzer anonym äußern, sondern vielmehr, dass etwas Entscheidendes fehlt: Der Augenkontakt, die Mimik, die Gestik, die Stimme des Gesprächspartners – einfach das gesamte physische Gegenüber. Diese sogenannte „Unsichtbarkeit“ enthemmt uns, und die ein oder andere unangebrachte Bemerkung rutscht uns leichter über die Lippen oder besser gesagt: über die Tastatur.
Ein Schlag ins Gesicht
Kritisiert wird niemand gern. Erst recht nicht, wenn es keine konstruktive Kritik ist. Beleidigungen und Beschimpfungen gehen weder im Netz, noch persönlich. Besonders dann nicht, wenn es im beruflichen Umfeld ist. Dass mein Kunde mit einem Beitrag, der Leute zur Selbstreflexion zwingt, Gegenwind bekommen würde, war von Anfang an klar. Aber nicht auf diese Art und Weise. Für Betroffene ist das verletzend. Darüber hinaus entsteht schnell eine Gruppendynamik. Mobbt einer, springen andere auf den Zug auf und mobben mit.
#nohate
Also Leute, wo würden wir hinkommen, wenn wir alle einer Meinung wären? Das wäre ja sterbenslangweilig! Ich lese mir auch gerne Kritik durch, wenn ich etwas damit anfangen kann und sie nachvollziehbar ist. Wüste Beschimpfungen und persönliche Beleidigungen finde ich einfach nur lächerlich und zeugen für mich von einem schwachen Charakter. Manchmal hilft es auch sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und nachzudenken, bevor man tippt – das hilft sowieso immer ganz gut.

Befragt man Google nach einer Definition für den Begriff Werbung, dann findet der Suchende folgendes vor: Als Werbung wird die Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit […], zwecks Bekanntmachung, Verkaufsförderung oder Image¬pflege von meist gewinnorientierten Unternehmen […] verstanden. Durch die kaufmännisch-enzyklopädische Brille betrachtet, wurde hier sicherlich der Nagel auf den Kopf getroffen. Ersetze ich sie aber wieder durch mein schwarzes, nerdiges Modell, dann greift die Definition schlichtweg zu kurz. Denn: Die Bedeutung von Werbung geht noch weit über den betriebswirtschaftlichen Aspekt hinaus. Sie ist immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und obliegt damit – wie alle anderen gesellschaftlichen Strukturen – einer gewissen Dynamik.
Ausschlaggebend für diesen Beitrag war für mich die aktuelle Werbung des Vergleichsportals Check24. Statt auf den hysterisch singenden Paul in schrillen Badeklamotten setzt das Unternehmen fortan auf „2 unvergleichliche Familien“. Mit den Bergmanns und den Krugers flimmern seit September zwei skurrile, aber dennoch irgendwie normale Familien über unsere Mattscheibe. Skurril, weil sie mit ihrer Familienstruktur, ihrer Redensart und ihren alltäglichen Problemen zwischen den klassischen Familienbildern im deutschen Werbefernsehen herausstechen. Irgendwie normal – ja, weil sie eben genau das tun. Das war nämlich nicht immer so – wie eine kleine Zeitreise durch das Familienbild der deutschen Werbung zeigt:
Die 80er und 90er: Mutti weiß, was gut ist
1988 zeigt uns Hohes C eine bieder gekleidete Mutter mit Pagenschnitt, die – während undefinierbare Dudel-Musik im Hintergrund läuft – den Tisch für ihre Kinder eindeckt. Anstatt eines großen Festmahls erwartet die Sprösslinge aber nur ein Glas Hohes C, um sie mit den wertvollen Kräften des Fruchtfleischs zu versorgen. Viel mehr passiert hier auch die nächsten Jahre nicht: Auch in den 90ern folgt die tägliche Dosis Vitamin-C immer noch auf eine kleine, ausgelassene Spielrunde des Kindes – ausgehändigt durch die fürsorgliche Mutter. Eine ähnliche Rolle nimmt auch die Mutter im Fruchtzwerge-Spot von Danone ein. Die Eltern (er: stilecht in Hemd und Pullunder) sitzen schach-spielend am Esstisch. Das Kind kommt aus dem Off und freut sich über einen Fruchtzwerg von der Mutter. Ein Fruchtzwerg soll es sein – eben wie ein kleines Steak (Ein kleines Steak? Oh man! Was war da damals los?). Immer noch in der Beraterfunktion, aber immerhin raus aus den eigenen vier Wänden trauen sich die Damen aus der Milchschnitten- und Quenchwerbung (für alle U30: Quench ist ein Erfrischungsgetränk). Es kommt zu einem Treffen unter Nachbarinnen im Vorgarten. Gesprochen wird – wie soll es auch anders sein – über gesunde Snacks für die Kleinen.
Auf die Klischee-Spitze treibt es allerdings die Nutella-Werbung. Nicht, weil hier derselbe Panflöten-Spieler zu hören ist, wie in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, sondern weil Mutter und Tochter den unwissenden Vater über die elementaren Unterschiede zwischen normalem Schokoaufstrich und Nutella aufklären. Er, der Bürohengst schlechthin, griff beim Wocheneinkauf natürlich zur falschen Schokocreme (Experten wissen: Anfängerfehler!). Aber damit nicht genug: Nutella treibt die Klischees mit dem Schlusssatz auf die Spitze: „Mütter wissen: Nur wo Nutella drauf steht, ist auch wirklich Nutella drin“. Danke dafür, Nutella! Mein Fazit also aus den vergangenen Jahrzehnten: Mutti weiß, was gut ist. In ihrem natürlichen Lebensraum – dem Zuhause (inklusive Vorgarten) – brilliert sie als Haushalts-Hacker und Vorsorgekünstler in Personal-Union, und ist – ganz wichtig – immer völlig souverän. Damit nimmt die Mutti der 80er und 90er Jahre – von mir liebevoll Hilde getauft – eine ganz besondere Rolle ein: Sie ist der Motor einer gut funktionierenden und harmonischen Familie und damit eine elementare Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung.
Irgendwie wirkt es sogar fast so, als hätte Hilde damals weder Sorge noch Stress empfunden (fernab eines Vitaminmangels des Kindes), aber wahrscheinlich war es genau das, was die Gesellschaft sehen wollte: eine weichgespülte Familie, bei der es einfach läuft.
2016: Mary – zwischen Büro, Familien- und Alltagsstress
Die Werbung von heute wirkt da wie ein Kulturschock. 2014 sehen wir bei Hohes C statt der Fruchtsaft-verteilenden Hausfrau eine berufstätige Mutter, die ihren liebesbedürftigen Sohn aufgrund eines wichtigen Telefongesprächs mit dem Büro vertröstet. Nanu? Eine schlechte Mutter oder einfach ein lebensnahes Beispiel für viele Mütter in der heutigen Zeit? Bei der Toffifee-Werbung trifft man zwar immer noch auf die mit Gardinen und Tisch-Zelten spielenden Kinder, allerdings sieht man heute auch Eltern, die den eingehenden Anruf vom Office wegdrücken. Die Message: Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Einen ähnlichen Ton stimmt die aktuelle Aldi-Werbung an: Hier predigt eine Kinderstimme von der Notwendigkeit eines entschleunigten Lebens. Es geht darum, Momente mit der Familie zu genießen und lästigen Alltagsstress wegzuschieben. Zurück bei den Bergmanns und Krugers sehen wir statt artiger Kinder eine pubertierende Tochter, die ihren Vater ankeift „Papa! Was schreist Du denn so? Schreib mir doch einfach eine WhatsApp!“. Und in der IKEA-Werbung stolpert der Zuschauer neuerdings über ein Schlafsofa. Eines, das Vater und Mutter in weiser Voraussicht vorbereitet haben, da der Sohnemann sie bald anflunkern wird: „Mia hat den Bus verpasst und pennt heut‘ bei mir“.
Situationen und Bilder, die vor 20 Jahren in der Werbung noch undenkbar gewesen wären. Nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil es dieses eine – ganz bestimmte – Bild einer gut funktionierenden Familie zu wahren und zu leben galt. 2016 sieht das bekanntlich etwas anders aus. Es geht um Themen wie Work-Life-Balance, Quality Time und Eltern, die trotz Alltagsstress ihr Familienleben wuppen müssen – eben völlig andere Lebenssituationen. Eine gut funktionierende Familie definiert sich daher längst nicht mehr über hausfrauliche Brillanz, sondern über ein gutes Familien-Management.
Werbung im Jahr 2016 ist damit aber auch ein Balance-Akt. Denn: Sie darf und soll alltägliche Probleme thematisieren – andernfalls läuft sie Gefahr, uns Zuschauer nicht zu erreichen. Trotzdem darf Werbung die Probleme aber weder bagatellisieren noch dramatisieren. Wie riskant diese Gratwanderung sein kann, zeigte uns letztes Jahr der Edeka-Spot. Der Clip „#heimkommen“ hielt den Zuschauern, pünktlich zum Weihnachtsfest, den ungeschönten Spiegel der Realität vor – und förderte damit zwangsläufig die Frage zu Tage: Wie viel Realität wollen wir in der Werbung wirklich sehen?
dmexco 2016: die Veranstaltung tat sich schwer mit neuen Impulsen, richtungsweisenden Debatten und echten Kontroversen. Eine Folge des ungebremsten Wachstums der Messe?
 Was soll man noch eine Woche nach der dmexco berichten, wenn schon die Berichterstatter vor Ort ihre liebe Not hatten? So lesen wir in der Rubrik „Die besten Sprüche der dmexco“ (Horizont) Sätze wie „Wir helfen dabei, den Bereich der Online-Werbung wieder aufzuräumen“, „In der echten Welt testen die Werbungtreibenden Facebook“ oder auch „Content Marketing ist mehr als unterhaltsame Werbung“. IT-ZOOM kürt Augmented Reality und Virtual Identity sowie Mobile, CRM, Social Media und Influencer Marketing zu den Top-Trends der Veranstaltung. Und Stan Sugarman stellt im Handelsblatt ein Produkt vor, das sagt, welche Zielgruppe, welcher Zeitpunkt, welcher Kanal und welcher Inhalt zur Ansprache gewählt werden müssen. Jeder Touchpoint sei wichtig und führe zum Kunden.
Was soll man noch eine Woche nach der dmexco berichten, wenn schon die Berichterstatter vor Ort ihre liebe Not hatten? So lesen wir in der Rubrik „Die besten Sprüche der dmexco“ (Horizont) Sätze wie „Wir helfen dabei, den Bereich der Online-Werbung wieder aufzuräumen“, „In der echten Welt testen die Werbungtreibenden Facebook“ oder auch „Content Marketing ist mehr als unterhaltsame Werbung“. IT-ZOOM kürt Augmented Reality und Virtual Identity sowie Mobile, CRM, Social Media und Influencer Marketing zu den Top-Trends der Veranstaltung. Und Stan Sugarman stellt im Handelsblatt ein Produkt vor, das sagt, welche Zielgruppe, welcher Zeitpunkt, welcher Kanal und welcher Inhalt zur Ansprache gewählt werden müssen. Jeder Touchpoint sei wichtig und führe zum Kunden.
Mehr allgemein gültiger Konsens ist wahrscheinlich nur schwer herzustellen. Und so stellt sich die Frage, ob man von der „globalen Business- und Innovationsplattform der digitalen Wirtschaft“ inhaltlich nicht ein kleines bisschen mehr erwarten kann: Etwas wirklich Richtungsweisendes? Neuen Diskussionsstoff für die Branche? Zumindest eine echte Kontroverse? So ist es nicht mehr als ein gigantisches Silvester-Feuerwerk. Vorfreude. Es wird bunt, es wird laut. Danach nichts: Stille. Und dann wieder ein Jahr Pause. Schade.
Schade vor allem deshalb, weil die dmexco ja wirklich die idealen Voraussetzungen bietet, inhaltlich echte Impulse zu setzen: Größe, Top-Speaker, mediale Aufmerksamkeit. Dass sie sich damit zunehmend schwerer tut, dürfte nicht zuletzt an ihrem eigenen Erfolg liegen. Denn: Je mehr Aussteller und je mehr Branchen unter das gemeinsame Dach schlüpfen, desto schneller schrumpft der kleinste gemeinsame Nenner. „Digital is everything – not every thing is digital“ lautete etwa das diesjährige Motto. Das ist so herrlich generisch, dass natürlich problemlos die Themen Outernet, Virtual Reality, Big Data und viele weitere darunter passen. Und: Je größer die Messe selbst, desto opulenter auch der flankierende Kongress. Bei rund 250 Stunden Programm werden eben viele Themen an-, aber wenige ausdiskutiert. Ein typisches Beispiel dafür ist die Arbeitswelt von morgen. Demnach sehen rund zwei Drittel aller Befragten einer Umfrage die Unternehmenskultur als größte Herausforderung für Deutschland 4.0. Allein das wäre wahrscheinlich schon ein tagfüllender Programmpunkt und eben auch „Pure Business“. Wo liegen in der Praxis die Knackpunkte? Was sagen Unternehmenslenker, Mitarbeiter, Agenturen und Unternehmensberater? Sind Firmen im Ausland weiter? Und so ging nicht nur der ein oder andere Besucher in den Hallen verloren, sondern häufig leider auch der rote Faden.
Welch schwieriger Balanceakt es ist, reines Größenwachstum und thematische Fokussierung auszupendeln, zeigt nicht zuletzt die CeBIT, die sich ja auch als Plattform für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft verseht. Seit vielen Jahren sind, trotz mehrfach veränderter Geschäftskonzepte, die Besucherzahlen rückläufig. Das ist in Köln nicht absehbar, aber die Frage, wie groß die dmexco überhaupt noch werden kann/sollte, drängt sich angesichts der diesjährigen Veranstaltung förmlich auf.