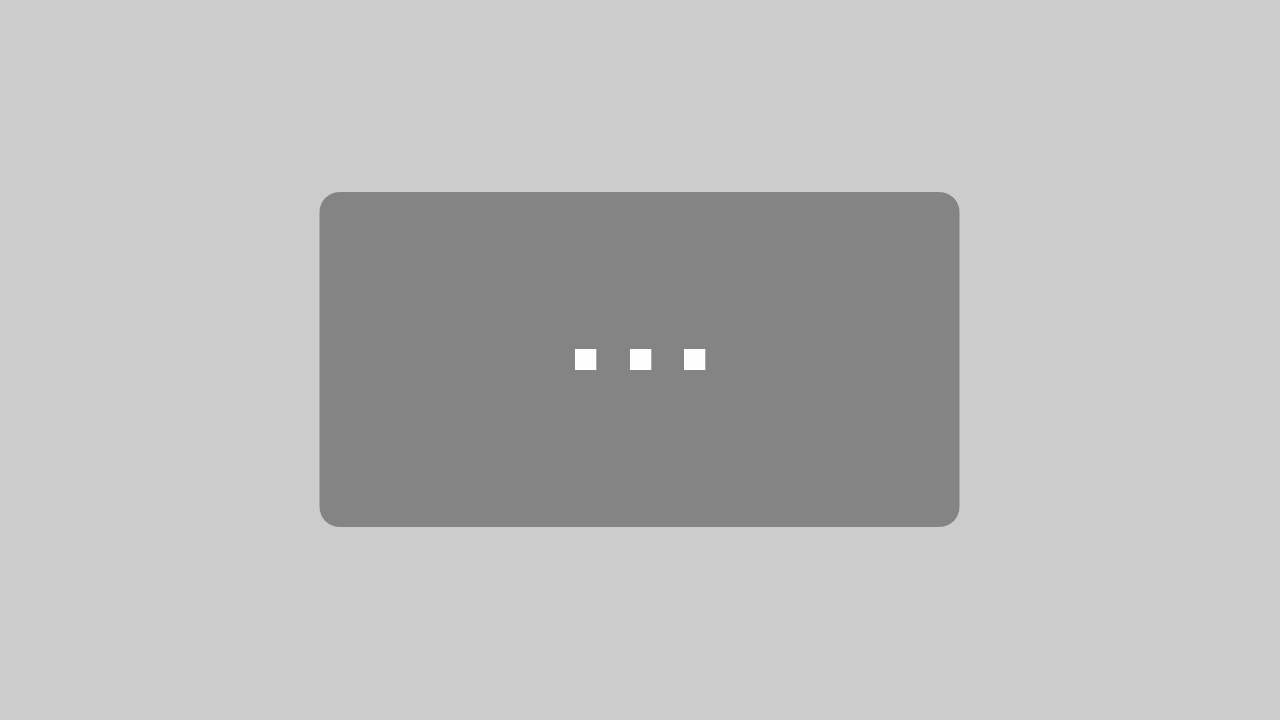Befragt man Google nach einer Definition für den Begriff Werbung, dann findet der Suchende folgendes vor: Als Werbung wird die Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit […], zwecks Bekanntmachung, Verkaufsförderung oder Image¬pflege von meist gewinnorientierten Unternehmen […] verstanden. Durch die kaufmännisch-enzyklopädische Brille betrachtet, wurde hier sicherlich der Nagel auf den Kopf getroffen. Ersetze ich sie aber wieder durch mein schwarzes, nerdiges Modell, dann greift die Definition schlichtweg zu kurz. Denn: Die Bedeutung von Werbung geht noch weit über den betriebswirtschaftlichen Aspekt hinaus. Sie ist immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und obliegt damit – wie alle anderen gesellschaftlichen Strukturen – einer gewissen Dynamik.
Ausschlaggebend für diesen Beitrag war für mich die aktuelle Werbung des Vergleichsportals Check24. Statt auf den hysterisch singenden Paul in schrillen Badeklamotten setzt das Unternehmen fortan auf „2 unvergleichliche Familien“. Mit den Bergmanns und den Krugers flimmern seit September zwei skurrile, aber dennoch irgendwie normale Familien über unsere Mattscheibe. Skurril, weil sie mit ihrer Familienstruktur, ihrer Redensart und ihren alltäglichen Problemen zwischen den klassischen Familienbildern im deutschen Werbefernsehen herausstechen. Irgendwie normal – ja, weil sie eben genau das tun. Das war nämlich nicht immer so – wie eine kleine Zeitreise durch das Familienbild der deutschen Werbung zeigt:
Die 80er und 90er: Mutti weiß, was gut ist
1988 zeigt uns Hohes C eine bieder gekleidete Mutter mit Pagenschnitt, die – während undefinierbare Dudel-Musik im Hintergrund läuft – den Tisch für ihre Kinder eindeckt. Anstatt eines großen Festmahls erwartet die Sprösslinge aber nur ein Glas Hohes C, um sie mit den wertvollen Kräften des Fruchtfleischs zu versorgen. Viel mehr passiert hier auch die nächsten Jahre nicht: Auch in den 90ern folgt die tägliche Dosis Vitamin-C immer noch auf eine kleine, ausgelassene Spielrunde des Kindes – ausgehändigt durch die fürsorgliche Mutter. Eine ähnliche Rolle nimmt auch die Mutter im Fruchtzwerge-Spot von Danone ein. Die Eltern (er: stilecht in Hemd und Pullunder) sitzen schach-spielend am Esstisch. Das Kind kommt aus dem Off und freut sich über einen Fruchtzwerg von der Mutter. Ein Fruchtzwerg soll es sein – eben wie ein kleines Steak (Ein kleines Steak? Oh man! Was war da damals los?). Immer noch in der Beraterfunktion, aber immerhin raus aus den eigenen vier Wänden trauen sich die Damen aus der Milchschnitten- und Quenchwerbung (für alle U30: Quench ist ein Erfrischungsgetränk). Es kommt zu einem Treffen unter Nachbarinnen im Vorgarten. Gesprochen wird – wie soll es auch anders sein – über gesunde Snacks für die Kleinen.
Auf die Klischee-Spitze treibt es allerdings die Nutella-Werbung. Nicht, weil hier derselbe Panflöten-Spieler zu hören ist, wie in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, sondern weil Mutter und Tochter den unwissenden Vater über die elementaren Unterschiede zwischen normalem Schokoaufstrich und Nutella aufklären. Er, der Bürohengst schlechthin, griff beim Wocheneinkauf natürlich zur falschen Schokocreme (Experten wissen: Anfängerfehler!). Aber damit nicht genug: Nutella treibt die Klischees mit dem Schlusssatz auf die Spitze: „Mütter wissen: Nur wo Nutella drauf steht, ist auch wirklich Nutella drin“. Danke dafür, Nutella! Mein Fazit also aus den vergangenen Jahrzehnten: Mutti weiß, was gut ist. In ihrem natürlichen Lebensraum – dem Zuhause (inklusive Vorgarten) – brilliert sie als Haushalts-Hacker und Vorsorgekünstler in Personal-Union, und ist – ganz wichtig – immer völlig souverän. Damit nimmt die Mutti der 80er und 90er Jahre – von mir liebevoll Hilde getauft – eine ganz besondere Rolle ein: Sie ist der Motor einer gut funktionierenden und harmonischen Familie und damit eine elementare Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung.
Irgendwie wirkt es sogar fast so, als hätte Hilde damals weder Sorge noch Stress empfunden (fernab eines Vitaminmangels des Kindes), aber wahrscheinlich war es genau das, was die Gesellschaft sehen wollte: eine weichgespülte Familie, bei der es einfach läuft.
2016: Mary – zwischen Büro, Familien- und Alltagsstress
Die Werbung von heute wirkt da wie ein Kulturschock. 2014 sehen wir bei Hohes C statt der Fruchtsaft-verteilenden Hausfrau eine berufstätige Mutter, die ihren liebesbedürftigen Sohn aufgrund eines wichtigen Telefongesprächs mit dem Büro vertröstet. Nanu? Eine schlechte Mutter oder einfach ein lebensnahes Beispiel für viele Mütter in der heutigen Zeit? Bei der Toffifee-Werbung trifft man zwar immer noch auf die mit Gardinen und Tisch-Zelten spielenden Kinder, allerdings sieht man heute auch Eltern, die den eingehenden Anruf vom Office wegdrücken. Die Message: Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Einen ähnlichen Ton stimmt die aktuelle Aldi-Werbung an: Hier predigt eine Kinderstimme von der Notwendigkeit eines entschleunigten Lebens. Es geht darum, Momente mit der Familie zu genießen und lästigen Alltagsstress wegzuschieben. Zurück bei den Bergmanns und Krugers sehen wir statt artiger Kinder eine pubertierende Tochter, die ihren Vater ankeift „Papa! Was schreist Du denn so? Schreib mir doch einfach eine WhatsApp!“. Und in der IKEA-Werbung stolpert der Zuschauer neuerdings über ein Schlafsofa. Eines, das Vater und Mutter in weiser Voraussicht vorbereitet haben, da der Sohnemann sie bald anflunkern wird: „Mia hat den Bus verpasst und pennt heut‘ bei mir“.
Situationen und Bilder, die vor 20 Jahren in der Werbung noch undenkbar gewesen wären. Nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil es dieses eine – ganz bestimmte – Bild einer gut funktionierenden Familie zu wahren und zu leben galt. 2016 sieht das bekanntlich etwas anders aus. Es geht um Themen wie Work-Life-Balance, Quality Time und Eltern, die trotz Alltagsstress ihr Familienleben wuppen müssen – eben völlig andere Lebenssituationen. Eine gut funktionierende Familie definiert sich daher längst nicht mehr über hausfrauliche Brillanz, sondern über ein gutes Familien-Management.
Werbung im Jahr 2016 ist damit aber auch ein Balance-Akt. Denn: Sie darf und soll alltägliche Probleme thematisieren – andernfalls läuft sie Gefahr, uns Zuschauer nicht zu erreichen. Trotzdem darf Werbung die Probleme aber weder bagatellisieren noch dramatisieren. Wie riskant diese Gratwanderung sein kann, zeigte uns letztes Jahr der Edeka-Spot. Der Clip „#heimkommen“ hielt den Zuschauern, pünktlich zum Weihnachtsfest, den ungeschönten Spiegel der Realität vor – und förderte damit zwangsläufig die Frage zu Tage: Wie viel Realität wollen wir in der Werbung wirklich sehen?