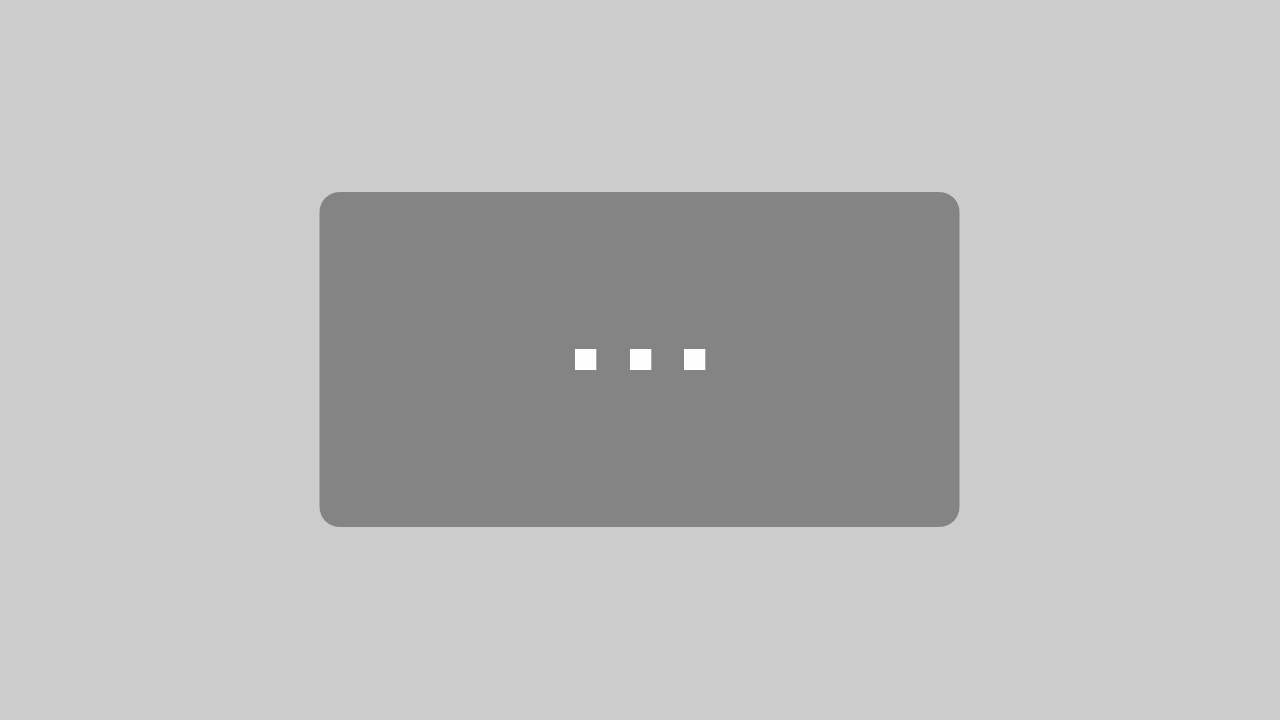Woche drei im Remote Work-Modus bricht bei uns an. Und man weiß derzeit nicht so recht, wovon es gerade mehr gibt: Wohlmeinende Experten-Tipps, wie man aus der Ferne miteinander kommuniziert oder digitale Tools, die einem die neue Arbeitswelt erst richtig möglich machen? Die Virtuosität geschwind und mühelos von einem Kanal auf den anderen switchen zu können, etabliert sich gerade als neues Statussymbol der Büromenschen. Asana, Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Trello, Zoom – wer hat mehr im Relevant-Set? Aber zugegeben: Ist ja teilweise auch ganz lustig – vor allem unsere Montags-Meeting im Video-Chat.
Interessant ist: Allen Kollegen steht Homeoffice frei, doch nicht alle nutzen es. Zumindest nicht alle ausschließlich. Und auch die, die zuhause arbeiten, haben ihren ganz eigenen Rhythmus. Da lohnt doch glatt der Versuch einer kleinen Typologisierung des coco-Teams. Los geht’s!
Die Pendler
Pendler sind pure Pragmatiker. Sie arbeiten dort, wo es gerade am besten passt. Lara zum Beispiel meint: „Meinen Arbeitsort mache ich von den To-Dos abhängig. Wichtig ist, dass die notwendige Technik da ist, um gut arbeiten zu können. Aber an manchen Tagen arbeite ich aus dem Home-Office effektiver, da ich fürs Texten genug Ruhe habe“. So kriegen sie mühelos alles unter einen Hut und halten die perfekte Office- & Homeoffice-Balance. Der persönlich-direkte Austausch mit den Kollegen ist gegeben, an anderen Tagen wiederum können sie flexibel auch mal auf die Schnelle andere Dinge erledigen – vor allem, weil dann ja auch die Anfahrt in die Agentur entfällt.

Die Traditionalisten
Die Traditionalisten wirken auf den ersten Blick so, als hätten sie sich möglicherweise zu lange in ihrem Leben mit der japanischen Bürokultur beschäftigt. Anwesenheit ist Pflicht. Und so schleppen sie sich auch in Zeiten höchster gesundheitlicher Gefährdung Tag für Tag in die Agentur. Ein Irrsinn? Nicht ganz. Es gibt auch gute Gründe – und nicht nur, weil überall die Büros leergefegt und damit wahrscheinlich die sichersten Orte im ganzen Lande sind. Die klare Trennung von Beruf und Privat hat klare Vorteile, wie etwa Tea meint: „Auf dem Weg zur Arbeit kann ich mich gedanklich schon auf die To-Dos des Tages einstellen, umgekehrt auf dem Heimweg bewusst abschalten. Beruf und Privates vor allem räumlich zu trennen, ist für mich Voraussetzung. Es spricht aber nichts dagegen, ab und an mal ins Home-Office zu wechseln“. Was Traditionalisten nur ungern zugeben: Hin und wieder würden sie sich auch gern mal auf dem Sofa lümmelnd einen Text – zum Beispiel diesen hier – verfassen oder das Kundenmeeting via Zoom in Jogginghose abhalten.

Die Zukunftsbewältiger
Der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari hätte seine helle Freude an ihnen, sie liefern garantiert Stoff für einen mindestens 2.000 Seiten dicken Schmöker: die Zukunftsbewältiger. Der Beweis, dass sich die Menschheit im Jahre 2020 gerade einen entscheidenden Schritt weiterentwickelt. Sie heben die Grenzen zwischen Job und Privatleben komplett aus den Angeln, schreiben und konferieren, wo andere sich Kaffee und Kuchen munden lassen, ihr Mittagsschläfchen halten oder die Meerschweinchen füttern. Zwischen zwei Texten noch die eine Ladung Wäsche in den Trockner, Hanteltraining inmitten des Kundencalls oder Newsletter lesen während der buddhistischen Atemübungen? Überhaupt kein Problem. Nur eines hat die menschliche Evolution noch nicht überwunden. Alex weist darauf hin: „Mir fehlt manchmal der Kaffeeklatsch und die Gespräche beim Mittagessen – der Kontakt über Slack oder Videokonferenzen ist einfach nicht das gleiche“ Na, warten wir auf das Jahr 2021…

Die Disziplinierten
Mit geradezu protestantischem Arbeitsethos starten sie in den Tag: Da der Arbeitsweg wegfällt, nutzen sie die Zeit mit Sport. Trotz lässigem Home-Office-Outfit werden anschließend sogleich die Mails gecheckt, Newsletter gelesen, und dann geht’s auch schon los mit den To Dos des Tages. Alles, was Ablenkung verursachen könnte, blendet der disziplinierte Home-Office-Worker konsequent aus und fokussiert sich auf die wesentlichen Tasks bis zum Mittagessen. Hier beginnt die Zeit des Socializing: frisch kochen und mit den besten Freunden telefonieren oder mit ihnen direkt zum Essen verabreden. So deckt der Home-Officler seinen Bedarf an menschlichem Kontakt. Da man ja alleine vor sich hinwerkelt, gelingt die Textproduktion häufig deutlich schneller, als wenn Kollegen kurz mal unterbrechen. Juan bilanziert: „Home-Office ist super praktisch und gerade in der aktuellen Situation eine große Erleichterung. Allerdings können die eigenen vier Wände und der fehlende persönliche Kontakt zum Team auf Dauer doch herausfordernd werden“.